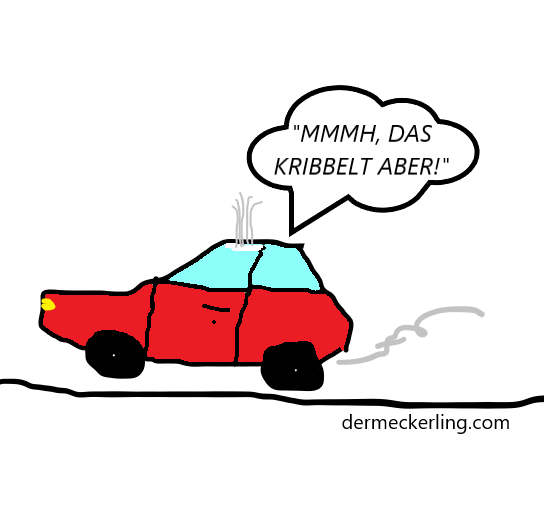Heute wurde mir zur Stärkung und Belohnung nach getaner Gartenarbeit, ein Cola-Cracker angeboten. Cola-Cracker. Das sind diese kleinen braunen zuckerhaltigen … ja was eigentlich? Von der Form her sind sie eine Mischung aus Schoko- und Marzipankugel und beherbergen hinter der glattlasierten glänzenden braunen Zuckerwand, einen Kern aus Brausepulver.
Früher kostete einer von ihnen DM 0,05 am KIOSK um die Ecke. Und nicht selten landeten 20 Stück von ihnen im Tausch gegen DM 1,- in der Papierspitztüte. Oder eben 10 Stück, wenn man nur noch DM 0,50 aus dem Sparschweinschlitz fischen konnte. Der Kiosk wurde erst von Familie Henke geführt und dann von Ebba Stratmann. Wir trugen dort unser Taschengeld hin und tauschten es – nach Erlaubnis der Eltern – gegen eine gemischte Tüte für DM 0,50,- (mit/ohne Lakritz) ein. Wir suchten selbst aus, integrierten ein Wassereis, 1 x Stück Schokolade Geschmacksrichtig unbekannt, Schlümpfe, saure Gurken, saure Stangen, Pilze, Smileys, Kaugummis, Cola-Flaschen, Lutscher und Cola-Cracker. Der Kiosk war ein Treffpunkt für uns Kinder in den Ferien. Während der Bauphasen sammelten wir Pfandflaschen im Umfeld der Bauwagen, gaben sie ab und reinvestierten in unsere Zahngesundheit.
Ich betrachtete den Cola-Cracker in meiner schmerzenden und vom Gartenhandschuhtragen noch ganz verschwitzten und schrumpeligen Hand – baden ist nichts dagegen. Er sah aus wie in den 90ern. Er roch wie in den 90ern. Und er schmeckte wie in den 90ern. Ein kleiner Blick auf das MHD an der Tüte bestätigt: sie sind aus den 90ern.
Zumindest suggerierte das der Geschmack meinem Gehirn und spielte meinem geistigen Auge einen scheinbar nie Enden wollenden Klingelstreich.
Während des Kauvorgangs, dem Kribbeln in der Nase und mit jedem mg Zuckerbrausemasse, das die Speiseröhre runterging, befand ich mich spürbar wieder im Nibelungenviertel in Schortens. Der Ort, an dem ich zwischen 5 und 27 mit meinen nicht pflegebedürftigen Eltern unter einem Dach lebte, und den ich auch heute noch als Heimat definiere. Das Nibelungenviertel war damals ein Neubaugebiet, das in mehreren Bauabschnitten auf ehemaligen Kuhweiden errichtet wurde. Viele Einfamilienhäuser mit zum Teil großzügigen Gärten. Jeder kannte irgendwann jeden, da man den Häusern täglich beim Wachsen zugucken konnte und gefühlt jede Woche woanders Richtfest gefeiert wurde. Durch das Neubaugebiet, das zwei ältere Bauabschnitte mit bereits asphaltierten Straßen, verband, führte eine Schotterstraße für Baufahrzeuge, von der Stichstraßen zu den Neubauten abgingen, die im Sommer sehr viel Staub aufwirbelte, aber sich sehr gut für Fahrradbremsspuren eignete. Bei Regen sammelte sich an manchen Stellen sehr viel Wasser und so kam es schonmal vor, dass man beim Durchqueren mit dem Rad einen „Nassen“(Schuh) bekam, oder wenn es ganz schlecht lief, komplett reinfiel, weil man noch nicht so firm im Radfahren war.
Einmal lief es sogar etwas schlecht für einen jungen Autofahrer, der nachts mit seinem Auto von der Straße abkam und es gegen einen Baum lenkte. In meiner Erinnerung soll es einen großen Knall gegeben haben, den mein Vater aufschrecken ließ und nach der Ursache schauen sollte. Die vier Insassen waren alle wohlauf und neben Blechschaden war es eine Eiche, die noch eine Zeit lang durch eine auffällige Schutzlasur mahnend an den Unfall erinnerte.
Es siedelten sich in dem Baugebiet viele Familien mit Kindern an, die früher oder später auch auf die sich in der Nähe befindliche Grundschule gingen. Bis es so weit war, hatte man sich in den Ferien gemeinsam viele Mutterbodenberge auf anderen Baustellen runtergerollt und sich gegenseitig mit darauf befindlichen Grassoden beworfen. Was aufgrund der verschmutzten Kleidung durchaus in einer Woche Hausarrest enden konnte.
Die älteren Kinder pafften heimlich Stroh und alle zusammen spielten auf dem neu errichteten Spielplatz den Klassiker „Anpetten!“. Ein Tischtennisrundlauf, bei dem jeder Teilnehmer drei Leben hatte und bei einem Fehler oder nicht erreichen des Balls ein Leben verlor. Die letzten beiden Spieler, spielten ein Finale und bekamen für einen Sieg, Joker, die sie im späteren Verlauf der neuen Runde wieder einsetzen konnten. Und wem das zu langweilig war, der spielte mit bei „Seesaw-Survivor“ oder zu Deutsch: „Wer kann sich am längsten auf der Wippe halten“.
Für gewöhnlich konnten auf jeder Seite der breiten Wippe, die von diesen blauen Federn in der Mitte balanciert wurde, 3 x Kinder nebeneinander sitzen. Waren es kleinere Kinder, waren es natürlich mehr als drei. In der Mitte auf der Freifläche, brauchten die oder der Schwunggeber zuerst Platz – sie standen breitbeining auf der Mittelplatte – und die sich bildenden Zwischenräume wurden mit weiteren mutigen Kindern und Jugendlichen aufgefüllt. Die kleinsten wurden aber überzeugt, zu ihrer eigenen Sicherheit runterzugehen. Oder sie wurden vom älteren Geschwisterteil so lange erpresst „Wenn Du nicht runtergehst, sage ich Mama und Papa dass Du eine Kassette mit Schimpfwörtern aufgenommen hast“ bis ich … äh sie „von alleine“ runtergingen.
Danach begannen die oder der Schwunggeber, mit Gewichtsverlagerung die voll beladenen Wippe in Bewegung zu bringen. Erst langsam, dann immer schneller. Nach und nach verabschiedeten sich die ersten Teilnehmer von der Wippe. Teils weil sie sich nicht mehr halten konnten, weil andere fallenden Kinder sie mitrissen oder weil ihnen von dem Auf- und Abgehopse auf den Sitzflächen der Hintern oder die Oberschenkel (von der waagerechten Haltestange) wehtaten.
Sieger war, wer neben den Schwunggebern als Letzter sitzenblieb. Logisch. „Survival of the fittest“ sagt man heute wohl dazu. Mit jeder Runde perfektionierten die Teilnehmer ihre Halteskills. Unter den Wippen-Enden bildeten sich tiefe Furchen, das MDF-Holz begann zu splittern, das Quietschen der Federn schrie „Aufhören!“ Ich glaube nicht, dass der TÜV damals geahnt hat, was dieses Spielgerät aushalten müsste.
Ich frage mich, wie man im Zusammenhang mit „Survial of the fittest“ heutzutage einen Wadenbeinbruch von damals einordnet? Das war nämlich das schlimmste Resultat eines scheidenden Mitspielers. Danach wurde schlagartig wieder vermehrt Tischtennis gespielt. Mit Wattebauschen.
Wir Grundschüler hatten nach Ende der Sommerferien den gleichen Schulweg. Zu Fuß. Unsere Eltern sprachen eine bestimmte Zeit ab, zu der man am Ende der Stichstraße stehen und auf die anderen warten sollte. Wir schauten nach rechts, sahen die anderen ankommen und schloss uns ihnen an. Nach fünf Minuten war man da. Ohne Ampel oder Straßenüberquerung.
Die einzige Gefahr waren die Bundis, die freitags nach Feierabend im Rahmen der „NATO-Rallye“ mit ihren tiefergelegten Golfs, VW Jettas und 3er BMW’s, durch die Straßen bretterten, um eine nervige Ampelkreuzung an der Hauptstraße zu umgehen. Ihnen waren dann die neu errichteten und rot gepflastert Huggel oder Hubbel zu verdanken, die sie zum langsam fahren animieren sollten. Heute frage ich mich, ob sie damals auch schulpflichtige Kinder hatten und auch ohne rote Hubbel rücksichtsvoll gefahren wären?
Früher war das ja ohnehin irgendwie anders. Da gab’s im Auto auch noch kein Spotify, um das Lieblingslied auf Knopfdruck abspielen zu können. Mit Glück lief das zufällig im Radio, sofern es das gewünschte Lied aus den Charts in die Playlist von Radio Bremen 1 – Hansawelle geschafft hatte. Oder, man hatte eine Musikkassette – selbst aufgenommen aus dem Radio oder gar das ALBUM mit DEM einen Hit – und konnte den Fahrer überreden, sie einzulegen. Ärgerlich nur, wenn das Gerät nicht vorspulen konnte.
Der einzige Knopfdruck an den ich mich erinnere, war der Zigarettenanzünder im roten Ford Escort meiner Kindergärtnerin Fräulein Janssen, die mich nach einem Familienumzug in das Neubaugebiet, im letzten Kindergartenjahr in den damaligen anderen Gemeindeteil, immer mitnahm, da sie zufälligerweise ein paar Straßen weiter wohnte. „Fräulein Janssen“. Nur weil sie nicht verheiratet war. Ihr damaliger Freund fuhr einen weißen OPEL Kadett GSI (!!!) mit gelben und grauen Streifen auf der Motohaube. GSI, GTI. Macht euch mal einen Begriff. Das war damals so etwas wie heute AMG, MPower oder RS irgendwas. Oder Tesla.
Das Fräulein mit der Vokuhila-Naturkrause inkl. Nackenspoiler rauchte Selbstgedrehte. Selbstverständlich im Auto. Und sie aschte bei geöffnetem Fahrerfenster, in den Ascher unter dem Radio. Wenn sie nicht ihr Gadget, die Tabakrolldose, dabei hatte, drehte sie sich ihre Zigaretten vor Fahrtantritt selbst. Manchmal steckte aber auch schon eine fertiggedrehte hinterm Ohr.
Der Tabak kam aus einem blauen Tabakbeutel, der auf ihren Schoß lag und immer knisterte, wenn sie Tabak rausnahm. Tabak ins Blättchen, zwischen Mittel-, Zeigefinger und Daumen beidhändig rollen, anlecken, verschließen und nochmal rollen. Der Überschüssige Tabak ging zurück in den Beutel und dann auf den Beifahrersitz. Die Zigarette verschwand hinterm Ohr. Dann betätigte sie den Anzünder und wartete.
Kurz nachdem der Zigarettenanzünder raus ploppte, hielt sie ihn an die vom Ohr in den Mund gewanderte Tabakkrolle. Es knisterte. Sie atmete ein und der süßliche Duft wanderte durch den Fahrgastraum in meine kleine Nase. Es kribbelte. Genau wie heute, als ich den Cola-Cracker verzehrte.